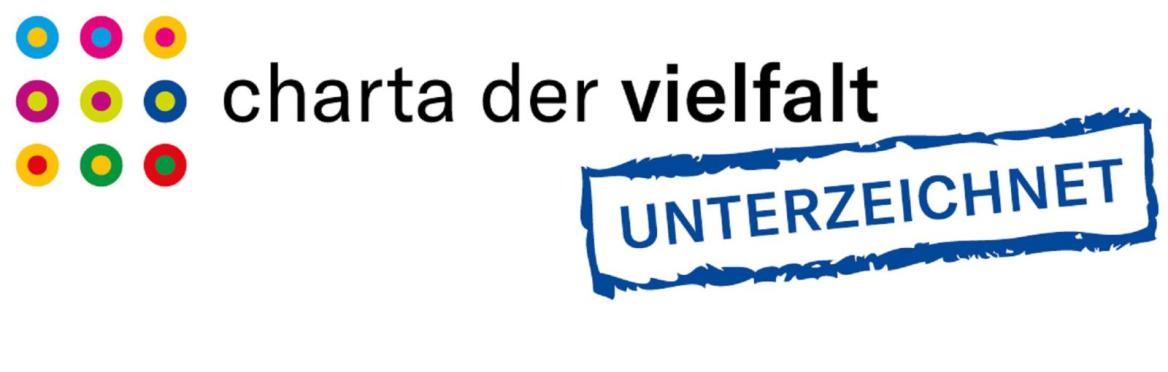Der Paritätische steht für Vielfalt. Und damit steht der Paritätische auch für unsere Gesellschaft. Denn unsere Gesellschaft ist vielfältig.
Wir wollen jeden Menschen in seinem Ich-Sein bestärken und unterstützen. Die LSBTTIQ*-Community steht seit einiger Zeit im besonderen Fokus. Sie fordert zurecht mehr Tatkraft gegen Diskriminierung und Gewalt ein, die in den letzten Jahren wieder zunimmt. Sie fordern dabei etwas Grundlegendes ein: gleiche Rechte. Und in ihrem Kampf für gleiche Rechte bleibt nicht aus, dass die Mehrheitsgesellschaft auf die bestehenden Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen und ja, auch strukturelle Homophobie aufmerksam gemacht wird. Und das ist auch gut so. Denn nur wenn wir darüber sprechen und aufzeigen, was zu tun ist, kann sich etwas verbessern.
Erst seit 1994 ist Homosexualität in Deutschland nicht mehr strafbar, erst seit 2017 ist die Ehe gleichgestellt („Ehe für Alle“). Auf dieser Seite wollen wir aufzeigen, wo das Thema LSBTTIQ* bereits beispielhaft im Paritätische steckt – und mit welchen Forderungen wir der Community zur Seite stehen.