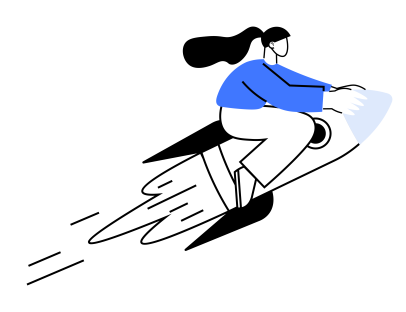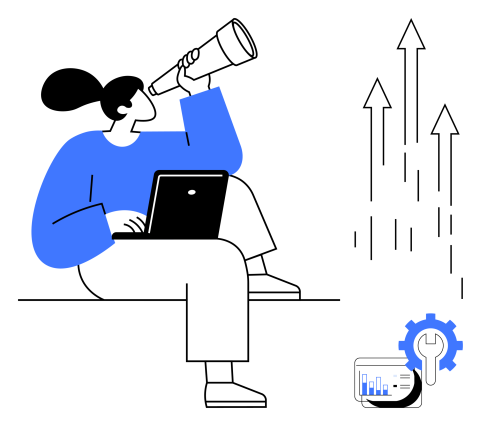Dieser Zusammenhang wird auch als „Matthäus-Effekt“ bezeichnet. Damit ist hier gemeint, dass am Arbeitsmarkt ohnehin privilegierte Personen auch häufiger an Weiterbildung teilnehmen und sich so bestehende Ungleichheiten im Erwerbsverlauf tendenziell eher verstärken, anstatt sich zu nivellieren. Befristet Beschäftigte, Teilzeitbeschäftigte und Zeitarbeitnehmer*innen hingegen nehmen seltener an Weiterbildung teil (BMBF 2024). Das trifft auch auf Beschäftigte zu, die Tätigkeiten ausüben, die potenziell eher durch moderne Technologien ersetzt werden können – dieser Zusammenhang wird als „automation training gap“ (Heß et al. 2023) bezeichnet.
Der betriebliche Kontext spielt eben- falls eine Rolle: Beschäftigte in Klein- betrieben oder in bestimmten Branchen wie dem Baugewerbe oder der Gastronomie sind seltener in Weiterbildung eingebunden (Leber / Schwengler 2023). Nicht zuletzt hängt die Weiterbildungsteilnahme auch von der Bereitschaft der Beschäftigten ab. Die Forschung zeigt, dass Geringqualifizierte häufiger an- geben, das Lernen nicht mehr gewohnt zu sein und den Nutzen von Weiterbildungen – etwa in Form finanzieller Vorteile – skeptischer beurteilen als formal Höherqualifizierte (Osiander / Stephan 2018).
Da Weiterbildung häufig im betrieblichen Kontext stattfindet, sind Arbeitslose von dieser Art der Qualifizierung faktisch ausgeschlossen. Deshalb ist die Förderung beruflicher Weiterbildung durch die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter von besonderer Bedeutung, um die Arbeitsmarktchancen von Arbeitslosen zu verbessern. Im Jahr 2023 gab es knapp 300.000 Eintritte in solche öffentlich geförderten Weiterbildungen. Rund 50.000 davon entfielen auf längere Maßnahmen, die zu einem berufsqualifizierenden Abschluss führen („Umschulungen“), etwas mehr als 16.000 auf sogenannte Teilqualifizierungen (Kruppe et al. 2024). Letztere bestehen aus modular aufgebauten kürzeren Lerneinheiten, die in ausgewählten Berufsfeldern Teile eines Berufsbildes abdecken. Im Idealfall können Teilnehmende mehrere Module nacheinander belegen, um über einen längeren Zeitraum zu einem Berufsabschluss zu gelangen.
Wissenschaftliche Evaluationen zeichnen insgesamt ein positives Bild dieser Weiterbildungsformen. Man vergleicht hierzu häufig Teilnehmende an Weiterbildungen mit „statistischen Zwillingen“, d. h. also Personen mit ähnlichen arbeitsmarktrelevanten Merkmalen. Diese Studien zeigen, dass Teilnehmende nach der Weiterbildung deutlich häufiger beschäftigt als Nichtteilnehmende. Auch für Teilqualifikationen gilt, dass diese die Beschäftigungschancen substanziell erhöhen; häufig besuchen Geförderte aber nur einen einzigen Kurs (Kruppe et al. 2024). Hindernisse, die eine Weiterbildungsteilnahme erschweren oder verhindern, sind z. B. ein schlechter Gesundheitszustand, ein niedriger formaler Bildungsabschluss – oft kombiniert mit schlechten Bildungserfahrungen – Betreuungspflichten gegenüber Kindern und Angehörigen oder (noch) unzureichende Deutschkenntnisse. Dies verdeutlicht, dass der Weg zu kontinuierlichem Lernen über den Erwerbsverlauf für manche Gruppen noch weit ist. Für die Arbeitsverwaltung bleibt es daher eine zentrale Aufgabe, diese Herausforderungen durch gezielte Beratung und passgenaue Maßnahmen zu adressieren.
Dr. Christopher Osiander studierte Sozialwissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und promovierte dort zum Thema „Berufliche Weiterbildung und Vermittlung von Arbeitslosen“. Seit 2009 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am IAB, derzeit bei der Stabsstelle „Forschungskoordination“ tätig.
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erforscht den Arbeitsmarkt in seiner gesamten Breite aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen und im gesellschaftlichen Kontext. Qualitativ hochwertige Forschung und umfassende, gesicherte Datengrundlagen bilden das Fundament für gute Politikberatung und professionellen Wissenstransfer.
Beitrag aus ParitätInform 3/2025